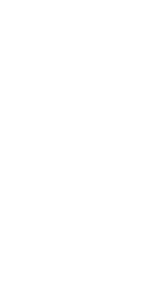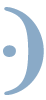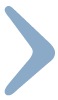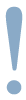Das gestohlene Jahr 2020
Von Sylvia Weigelt
Normalerweise komme ich erst nach Weihnachten, in den Tagen zwischen den Feiertagen, zu einer Rückschau auf das Jahr. Dann kehrt eine innere Ruhe ein, die mir während des „normalen“ Jahres mitunter abhandenkommt. Nun also bin ich gehalten, schon Anfang Dezember auf das Jahr zurückzuschauen. Warum nicht!? Schließlich war 2020 ja auch kein „normales“ Jahr, keines, das man so erwartet hätte.
Es fing schon mit dem Winter an, der weder im Januar noch im Februar so viel Schnee brachte, dass es zum Skilaufen im heimischen Thüringen reichte. Die Erderwärmung und der damit einhergehende Schneemangel bestimmten die oft hitzig geführten privaten wie öffentlichen Diskussionen. Wer dem entkommen wollte, reiste in die Alpen nach Österreich, wo es nicht nur ausreichend Schnee gab, sondern inzwischen auch das aus China eingewanderte CORONA-Virus fröhliche Verbreitung fand. Noch focht mich das alles kaum an. Erst als die Medien mit Bildern von Hunderten von Särgen in Italien das Ausmaß des „neuartigen“ Virus“ ebenso erschreckend wie wirkungsvoll auch in unser Haus brachte, überkam mich das gleiche beklemmende Gefühl wie am 11. September 2001. Hilflosigkeit nahm von mir Besitz. Umgehend kontaktierte ich alle engeren Verwandten und Freunde oder wurde von ihnen kontaktiert. Wir mussten uns vergewissern, dass es allen gut geht. Meine Mutter (93) bekam Panik; nicht, weil sie um ihre Gesundheit fürchtete, sondern weil sie um uns besorgt war. Schließlich hatte ihre Familie schon eigene Erfahrungen mit einer Pandemie gemacht, wie die Chronik von Bad Tennstedt zum Jahr 1919 überliefert: „Bei einer Familie auf dem Schulberg starben im Januar binnen einer Woche drei Familienangehörige an einer ansteckenden Krankheit.“ – Die ansteckende Krankheit war die Spanische Grippe und diese Familienangehörigen waren mein Urgroßvater und zwei seiner Töchter. Die Ältere hatte sich bei einem Besuch in Bonn angesteckt und das Virus so nach Hause gebracht. Die Mutter, zwei Söhne und eine Schwester blieben verschont. Nun erst weiß ich, weshalb die „Gross“, meine Urgroßmutter, die im Hause meiner Großeltern lebte, nie ein Lächeln für uns Kinder hatte und weshalb sie stets schwarz gekleidet war. Drei Särge im Haus, der Mann kaum über vierzig, die lebenslustigen Töchter noch keine zwanzig Jahre alt, das steckt man nicht einfach so weg, nicht nach einem Jahr, nicht nach zehn, offenbar niemals.
Hundert Jahre später nun also Corona, und dieses Mal bin ICH live dabei! Der erste Lockdown, zu Deutsch „Ausgangssperre“, wird Mitte März verkündet. Alles wird runtergefahren, keine Veranstaltungen, keine Lesungen, keine Treffen, keine Schule, keine Kontakte. Nachdem die erste Lähmung überwunden ist, kommt wieder Bewegung in meinen Alltag. Irgendwie muss, irgendwie wird es weitergehen! Die Buchmesse in Leipzig, für die ich bereits Termine mit zwei Verlagen für neue Projekte ausgemacht hatte, ist abgesagt, dafür kommen aus Erfurt die Vertragsdaten für die Lesung zur BUGA im August 2021. Bis dahin wird alles vorbei sein, denke ich und fülle die Formulare aus. Doch rechte Lust zum Arbeiten stellt sich nicht ein, alles, was ich an Projekten im Kopf und in Planung hatte, scheint auf einmal völlig unwichtig. Stattdessen verlagere ich meine Aktivitäten ins Internet. Nein, die öffentliche Präsentation im Netz ist nicht mein Ding, auch wenn es sie gibt, die kreativen Selbständigen, die Einfallsreichen. Eine Balletttänzerin im Internet ist zwar ästhetisch ein Genuss, doch das, was Ballett für mich ist, kann ich auf oder hinter dem Schirm nicht einmal erahnen. Eine Lesung per Video, so gut sie auch ist, kann das Interesse für das Buch und dessen Schöpfer/in wecken, doch die Glasscheibe verhindert jede Emotion auf beiden Seiten. Dennoch sind diese Aktionen wichtig, für die vor und für die hinter der Scheibe, zeigen sie doch, dass man gegenwärtig ist, jederzeit bereit, aus der Scheibe heraus- und wieder in die Welt einzutreten. Doch wie gesagt, Auftritte im Netz sind nicht mein Ding. Meine Netzaktivitäten beschränken sich vor allem auf einen sehr intensiven Austausch mit Freunden.
Freunde aus Innsbruck sind die ersten, die in Quarantäne müssen. Sie berichten: Da es gestattet ist, zum Luftschnappen ins Freie zu gehen, sind wir am Nachmittag ein Stück am Inn entlanggegangen. Innsbruck ist eine regelrechte Geisterstadt geworden. Ganz Tirol ist inzwischen unter Quarantäne, ohne Erlaubnis darf niemand seinen Wohnort verlassen.
Kurze Zeit später trifft es auch Jenaer Freunde: Ja, es ist alles nicht so einfach momentan, auch wenn wir uns als Rentner in einer vergleichsweise komfortablen Situation befinden, denkt man an die Leute, deren Existenz bedroht ist. Nicht jeder kann sich zurücklehnen und einfach abwarten. Unsere Quarantäne zeigt aber auch, dass man trotzdem in seltsame Zustände geraten kann. Allein das Gefühl, nicht alles tun zu können, was man möchte, ist auf Dauer schwer auszuhalten. Zum Glück gibt‘s die Literatur, die Musik und eine gesunde Partnerschaft, Familie und Freunde zählen jetzt mehr denn je.
Nicht nachvollziehbar sind die Anordnungen der Politik hinsichtlich der Quarantäneregeln. Während die unter Quarantäne Stehenden das Haus 14 Tage lang nicht verlassen dürfen, auch nicht zum Einkaufen, sitzen andere noch Ende März eng an eng in Flugzeugen. Passagiere, die aus aller Welt ankommen, werden nicht in Quarantäne geschickt. Sie drängen sich in den Hallen, gehen unbehelligt nach Hause und pflegen weiter soziale Kontakte. Wenn uns das mal nicht auf die Füße fällt! Weshalb gibt es keine Ausgangssperre? An warmen Tagen sind die Paradieswiesen dicht von jungen Menschen bevölkert, nur die Asiaten tragen – noch belächelt – einen Mundschutz. Die Bilder von Italien sollten jedem klarmachen, dass wir es hier nicht mit einem Spaß zu tun haben und dass jeder Verantwortung trägt. Ja, da hat man an alles Mögliche gedacht, aber dass auch uns so ein Virus völlig lahmlegt, hatte keiner auf dem Schirm. Wir können nur hoffen, dass alle weitgehend unbeschadet bleiben und wir danach unsere so selbstverständlich gewordenen Freiheiten bewusster genießen … Nehme mir Zeit, die Bücher des nun altersweisen de Bruyn chronologisch zu lesen. Die „Preisverleihung“ (1966) oder die „Neue Herrlichkeit“ (1985) begeistern mich. Mutig, was er damals schon von sich gibt. (Tagebucheintrag)
Kurzer Lagebericht einer Freundin aus England: Seit Mitte Februar bin ich wieder zu Hause in Salisbury. In England unterstützen wir einander, besonders Nachbarn, und das hilft. Neben mir wohnt eine Krankenschwester. Sie hat zwei Kinder, und ich freue mich jeden Abend, wenn sie erschöpft, doch gesund nach Hause kommt. Viele Leute sind gestorben, hier bisher knapp über 20. Jeden Donnerstag klatschen wir Beifall, wie alle anderen auch.
Anfang April fragt der FBK eine Kurzgeschichte für eine Anthologie an. Und ob ich will! Mit dieser für mich neuen Herausforderung kommt endlich die vermisste Lust am Schreiben in meinen Alltag zurück. Aus der Geschichte, die entsteht, könnte mehr werden …
Die großen Themen bleiben weiter präsent, im Privaten mehr als im Öffentlichen. Die Innsbrucker schreiben: Die durch Corona entstandene Ruhe war für uns lärmgeplagte Städter sehr angenehm. Man konnte sogar bei offenem Fenster schlafen. Doch mit dem Aufnehmen des „Normalbetriebs“ hört das nun wieder auf. Auch wir haben wenig Hoffnung, dass sich die Verhaltensweisen ändern werden. Gestern wurde in den Abendnachrichten gesagt, dass gerade jetzt sehr viele Lebensmittel weggeworfen wurden – ein Resultat der Hamsterkäufe. Wahrscheinlich werden die Menschen mit den kostbaren Lebensmitteln erst dann sorgsam umgehen (1 Million Tonnen werden jährlich in Österreich vernichtet), wenn diese sehr teuer werden (was bei dem Klimawandel nicht ausgeschlossen ist) oder sehr knapp. Aber lassen wir uns überraschen! Wichtig ist jetzt, dass die gebotenen Verhaltensregeln eingehalten werden, um eine zweite Coronawelle zu vermeiden. Wir hoffen, die Grenzen werden im Juni wieder geöffnet; denn wir wollen uns doch in diesem Jahr noch sehen!
31. Mai: Einladung des FBK zu Interview und Tonaufnahme – wieder ein freudig angenommener Arbeitstermin, der Lust auf mehr macht. Anfang September sind die Hörproben und das Interview im Netz. Das Eingebundensein in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter (FBK und VS) gibt mir ein gutes Gefühl. Als dazu ganz unerwartet ein postalischer Glückwunsch vom VS zum 60. (!) Geburtstag kommt, genieße ich einfach mein arbeitsmäßiges Gut-aufgehoben-Sein.
Inzwischen ist es Sommer geworden, Corona ist noch da, aber wir können wie geplant nach Mecklenburg und an die Nordsee fahren, auch wenn es einige Regeln zu beachten gilt. Und wir können uns mit den Innsbrucker Freunden zu einer gemeinsamen Wanderung treffen! Keine Möglichkeit gibt es indessen für das lieb gewordene Singen im Chor. Per Mail sprechen wir uns Mut zu: Bleibt weiterhin sangeslustig und vor allem gesund. Dafür können wir einige Veranstaltungen besuchen, die im Freien stattfinden. Wir wagen uns sogar in die Elbphilharmonie zu einem coronabedingt verkürzten Konzert.
Es ist November, die zweite Welle ist in vollem Gange, wieder gibt es einen Lockdown, etwas lockerer als der erste, aber wieder ohne Kunst und Gastronomie. Und nun scheint er auch bei mir angekommen zu sein, der Corona-Blues. Ich habe das Gefühl, das Jahr hat sich einfach so vorbeigeschlichen, ohne Konzerte, ohne Theaterbesuche, ohne Chorsingen, ohne gesellige Wanderungen mit willkommener Einkehr, ohne Lesungen und Vorträge. Am 9. November wird auch meine letzte verbliebene Lesung abgesagt. Das im Dezember geplante Treffen mit meinem Autorenkollegen R. ist auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, für neue Projekte fehlt mir gerade der Antrieb. Also am Ende doch ein gestohlenes Jahr?
Nein, ein „gestohlenes“ Jahr war es nicht. Jeder Tag war präsent, jeder Tag forderte mich mehr oder weniger, auch heraus, und manchmal geriet ich an meine Grenzen. Es brachte mich aus dem gewohnten Trott, führte zu einer neuen Sicht auf längst vertraute Dinge, nahm mir manches, das bisher so selbstverständlich meinen Alltag ausfüllte, erforderte Toleranz gegenüber dem Unabänderlichen. Aber es führte mich auch, mehr als ich dachte, auf mich selbst zurück, zwingt mich zum Nachdenken über das, was ich tue, auch über das, was ich nicht tue und von dem ich denke, dass ich es tun müsste …
[Aus Tagebucheinträgen und Mails zusammengetragen]

Sylvia Weigelt, 1952 in Thüringen geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Pädagogik. Sie blieb der Uni Jena treu, promovierte, habilitierte und arbeitete bis 2006 als Dozentin, seither ist sie freiberufliche Publizistin.
Zum Eintrag in der Autoren-Datenbank hier ».