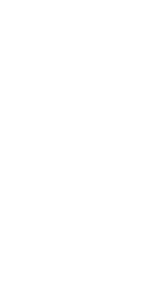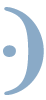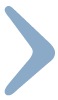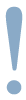Mein Himmel, so weit
Von Ingrid Annel
Es fing so gut an, das Jahr 2020. Mein Kinderbuch „Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten“ erblickte am 1. Januar das Licht der Welt. Genauer gesagt: das furiose, funkelnde Lichtergeflimmer, ringsum mit Karacho in den Himmel geworfen. Ein Freudenfeuer, das ich nicht einmal selbst zünden musste, ich böllere nicht.
Zugegeben, das Buch landete natürlich nicht Punkt Mitternacht auf dem Buchmarkt und auch nicht am Neujahrstag, da haben die Buchläden ja geschlossen. Aber der offizielle Erscheinungstermin am ersten Tag des neuen Jahres war ein hoffnungsvoller Start in ein Jahr voller Pläne.
Doch dann kam C. Es kam zunächst in Bildern, die sich ins Gedächtnis brannten: nächtliche Lkw-Kolonnen, große Zelte voller gestapelter Särge – in fernen Ländern. Aber das stumme Echo war schon zu vernehmen, diese lähmende Stille, die sich bald auch auf uns senkte.
Zu spüren bekam ich das Anfang März, als ich auf der Thüringen-Ausstellung meine Bücher präsentieren durfte. An allen Eingängen zur Messe Desinfektionssäulen, große Hallen mit gut bestückten Ausstellungsständen – und kaum Menschen. Ab und zu verirrte sich jemand an meinen Büchertisch. Ein Vorgeschmack aufs Jahr. Und die bange Frage: Wird die Leipziger Buchmesse stattfinden? Werde ich fahren? Werde ich mich unbefangen durch die überhitzten und zugleich zugigen Hallen bewegen können, zumal ein obligatorisches Mitbringsel in vergangenen Jahren immer ein veritabler Schnupfen war?
Die Messe wurde abgesagt. Nun musste ich nicht mehr selbst entscheiden: Fahren oder sicherheitshalber absagen? Eingeladen war ich zu einer Lesung im Theaterbus, der steht alljährlich zwischen den Messeständen und öffnet seine Türen für Kinderbuch-Lesungen. Die Lesung dort wollte ich als Startschuss nehmen, mir anschließend Lesungen in Schulen und Bibliotheken zu organisieren. Eigentlich.
Stattdessen begann eine Zeit, in der viele Sätze mit „Eigentlich“ eingeleitet wurden: Eigentlich hätte ich bald, wäre ich jetzt, wollte ich doch so gern … Es begann das Jahr der abgesagtesten und ausgefallensten Lesungen. Da ich aber meine Einnahmen hauptsächlich über Lesungen generiere, rollte und flatterte der Euro nur in Kleinstmengen auf mein Konto.
Viel Zeit zum Nachdenken. Eigentlich. Als aber im März die große Stopp-Taste gedrückt wurde, schienen auch meine Fähigkeiten, Gedanken in Worte fassen zu können, gestoppt worden zu sein. Ich verfolgte die Nachrichten im Fernsehen, las jede Zeile, die im Internet aufploppte, wollte verstehen, was Zeitungsartikel, Podcasts und populärwissenschaftliche Videos zu erklären versuchten: Was ist das, was da unsichtbar und doch mit einer ungeheuren Wucht und Wirkung um die Welt wandert?
Ich fiel aus der Zeit. Verfiel in Schockstarre. Wozu jetzt Lesungen organisieren, wenn in Schulen und Bibliotheken sowieso niemand zu erreichen ist? Wozu überhaupt noch Bücher schreiben, wenn gerade eine Welt zerbröselt und niemand weiß, wie die zukünftige aussehen wird? Tage im freien Fall. Was wird das werden, was wird mit mir werden, wie gehe ich damit um? Wie umgehe ich das? Wie kann ich mich aus all der Unsicherheit und Ungewissheit lösen und trotz alledem mein Leben mit Sinn füllen?
Was mir half: Ich kehrte gedanklich zurück zu einem besonderen Tag, zu einer merkwürdigen Woche, zu bangen Monaten im vergangenen Jahr, als ich schon einmal aus der Zeit fiel. An jenem besonderen Tag konnte ich nicht genug bekommen von der Schönheit der Welt.
Tags zuvor überfiel mich eine ärztliche Diagnose, ich wurde sofort ins Krankenhaus überwiesen, zur Narkose- und OP-Aufklärung. Die Operation sollte schnellstmöglich folgen, am besten gleich am nächsten Tag.
Doch den Tag nach der „Urteilsverkündung“ wollte ich noch für mich haben und erbat Aufschub. Im Kalender stand ein Drehtermin für einen Beitrag in der „Bücherkiste“, Romy Gehrke wollte mein Buch „Ein Kleid ganz aus Schnee“ vorstellen und in der Erfurter Altstadt Aufnahmen dafür drehen, ein Kameramann wartete, der Assistent dazu. Ich wollte nicht absagen, wollte diese Chance nutzen. Nun ganz unbedingt.
Dieser Tag war ein Geschenk. Ich konnte für die Dauer der Dreharbeiten alle Ungewissheiten (Werde ich bald sterben? Stehen nach der ersten Operation weitere Operationen an, mit nachfolgenden massiven Einschränkungen? Komme ich einigermaßen glimpflich davon?) vergessen. Ich konnte mich fallenlassen, konnte die Ängste loslassen, durfte spielen.
Denn das war gewünscht: dass ich ein bisschen spiele. Mit passenden Bildern und Filmsequenzen sollte der Charakter des Buches eingefangen werden.
Wir drehten am Ufer der Gera. Hinter der Lehmannsbrücke ein paar Treppenstufen hinab, ein schmaler Pfad am Wasser, Bäume links, altes Mauerwerk rechts. Romy hatte einen schwarzen Mantel besorgt, im Buch spielt er eine Rolle. Er passte wie maßgeschneidert. Ich zog ein kleines, blaues Holzpferd aus der Manteltasche, wir haben wieder und wieder probiert, diesen Moment einzufangen, in dem das Pferd von meiner geöffneten Handfläche aufstieg und zu schweben begann. Für weitere Aufnahmen wanderte mein Blick in die Kronen der mächtigen Bäume. Nach einem trübgrauen Morgen kam punktgenau die Sonne durch, flimmerte zwischen den Zweigen, im Fluss schnatterten Enten vorbei.
Ich war wie verzaubert von diesem Tag, von der Sonne, dem Fluss, den Bäumen, der Mauer aus wuchtigen Steinen, von all der Schönheit, die in mich strömte, die ich aufsaugte, die sich in mir ansammelte. Ich lehnte an der Mauer und war glücklich. Dennoch, trotz allem glücklich.
Am nächsten Tag, es war ein Feiertag, Himmelfahrt, erledigte ich die Steuerklärung und räumte ein bisschen mein Leben auf. Tags darauf verabschiedete ich mich in die Narkose, wurde operiert, wachte auf – und war nun dazu verurteilt, Geduld zu haben, zu warten. Viele Tage lang auf den ersten Befund, dann auf die Kontroll-OP, auf den zweiten Befund. In der Zeit begann ich, nicht nur gelegentlich, sondern täglich Runden durch und um unser Dorf zu drehen, kleinere, größere. Ich konnte mich nicht sattsehen an allem, was in den Gärten und in der freien Natur grünte und blühte und wuchs. Die Formen, die Farben, die Strukturen – die Natur ist eine fantastische Künstlerin. Damit konnte ich mich ablenken vom Warten, von diesem Schwebezustand, von der Ungewissheit, was weiter wird.
Ich hatte Glück, ich bin und bleibe unter ärztlicher Kontrolle. Freundinnen rieten, ich solle mir etwas Gutes tun, mir etwas gönnen. Ich entgegnete: Ich gönne mir den Luxus, mein Leben wie gewohnt zu leben, das wäre eigentlich schon Luxus genug. So kehrte ich zurück an den heimischen Schreibtisch, in den Alltag.
Und dann meldete sich im Frühjahr 2020 dieses Gefühl zurück: aus der Zeit gefallen zu sein. Doch nun kannte ich es schon. Ich sang, nur für mich, denn auch die Chorproben waren abgesagt: So seid nun geduldig, lieben Brüder. Und lieben Schwestern auch.
Nur – es klappte nicht immer mit der Geduld, mit der Gelassenheit, mit dem Warten auf bessere Zeiten, auf die Möglichkeit, endlich wieder zu Lesungen aufbrechen zu können. Sollte ich eine andere Form ausprobieren? Im Netz, per Video? Ich schaute mir Beispiele an, mit der Laptop-Kamera von schräg unten aufgenommen, die Akustik kein Vergnügen. Ich blieb ein paar Minuten hängen, dann gab ich auf. Nein danke, keine Alternative für mich. Ich brauche den Blick in die Augen des Publikums, die Resonanz, das Zusammenspiel.
Und endlich, im Sommer, die erste Lesung. Mein Mann und ich sind nach Stavenhagen eingeladen, um für den Museumsverein eine Lesung „Der schillernde Friedrich“ zu bestreiten. Unter freiem Himmel, auf dem Schlosshof leicht oberhalb der Stadt. Ein bisschen fürchte ich mich – nicht wegen der unsichtbaren Viren, sondern weil es der heißeste Nachmittag des Jahres ist und wir für eine reichliche Stunde lesen und erzählen wollen, im Stehen. Hoffentlich kippe ich nicht um, denke ich. Wir stehen im Schatten großer Bäume und lesen und erzählen. Vor uns die Leute auf Stühlen, weit auseinander gerückt. Wir blicken in aufmerksame, dankbare Gesichter. Diese Lesung haben wir schon oft „trainiert“, wir sind eingespielt, wissen, wann und wie wir die Leute zum Schmunzeln, zum Lachen bringen können – wir wollen ja keine trockene Schulstunde über unseren großen Klassiker zelebrieren. Doch das Lachen bleibt diesmal verhalten. Die Leute sitzen auf Distanz, sie können sich nicht anstecken. Weder mit Viren noch mit Lachen.
Läuft eine Lesung gut, wird man gleichsam vom Publikum getragen. Hier sitzen zwar viele, jedoch einzelne Leute, jeder für sich. Hier sitzt kein Publikum. Wieder und wieder stürze ich in den Leerraum zwischen den Stühlen.
Meinen Mann befällt Sorge, wie es werden wird im Erfurter Kabarett, mit mehr leeren als besetzten Stühlen, im geschlossenen Raum. Ich schlage vor, sicherheitshalber nur noch Programme zu spielen, in denen es nichts zu lachen gibt, um übermäßige Aerosol-Verbreitung zu vermeiden. Oder das Publikum soll zu Beginn des Abends gemeinsam üben, in die Armbeuge zu lachen.
Im September und Oktober darf ich ein paarmal lesen, für Kinder, für Erwachsene. Dann schrillt es wieder zur großen Pause.
Und nun? Ich tauche ab ins Lesen, ins Schreiben. Zwischendurch tauche ich auf, fliege aus, laufe durchs Dorf, über die Felder, durch den nahen Wald. Am Bach entlang, vorbei an meinen bizarren Freundinnen, den höhlenartigen Weiden, die fast nur noch Rinde sind und dennoch unentwegt austreiben. Über die Schwellenburg, die keine Burg ist, sondern ein länglicher Hügel nahe dem Ortsausgang. Der Anstieg ist steil, über ausgewaschene Rinnen, die Badlands. Am Wochenende herrscht hier reger Ausflugsverkehr, die Gaststätten haben geschlossen, die Museen, die Theater. Ich erkunde die weniger ausgetretenen Pfade auf der Nordseite, balanciere zwischen Mauselöchern und Gestrüpp, bestaune die Höhlen in den Gipsfelsen. Alle paar Meter eine neue Szenerie, eine neue Kulisse, hier könnte man spielen, Filme drehen.
In der Woche habe ich den Berg für mich. Ich stehe dort oben und denke: Mein Berg! Mein Himmel, so weit! Meine Welt, und ich darf dabei sein, mittendrin. Ich stehe dort oben, sehe im Norden das Kyffhäusergebirge, im Süden die Stadt, im Westen die Fahnerschen Höhen. Im Osten ein Gebäude, das ich schon von innen kennengelernt habe: die Hallen eines Zwischenbuchhändlers, mit imposanten Hochregallagern voller Bücher. Mit Unmengen von Büchern. Wer soll die alle lesen? Diese Flut, in der so schnell das eigene Buch untergehen kann.
Und doch setze ich mich zu Hause wieder an den Schreibtisch, füge Buchstaben zu Wörtern, Wörter zu Sätzen, Sätze zu Geschichten.
Und gut.

Ingrid Annel, studierte für ein Lehramt Physik, Mathematik, Germanistik und Kunsterziehung; später auch Literaturwissenschaften, arbeitete als Bauarbeiterin in der Ukraine, als Buchhändlerin, Dramaturgin und Lektorin. Seit 1988 arbeitet sie als freiberufliche Autorin.
Zum Eintrag in der Autorendatenbank hier.