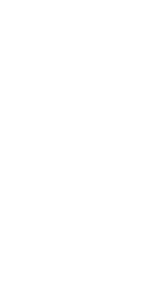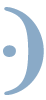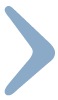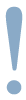Und über mir jene Corona Borealis
Von Elisabeth Dommer
Es ist Frühling. Ich sitze allein im kleinen Waldstück, auf dem lehnenlosen Bänkchen mit viel Vergangenheit und nur geringer Zukunft. Wer braucht es schon – die zwei, drei Leute auf dem Weg gehen ja lediglich von einem Dorf ins nächste. Ausruhen will ich mich auch gar nicht. Ich will bleiben. Einfach dasitzen, mitten im Grünen. Es ist April. Ich habe Zeit, ihn zu genießen. Aber innerlich bin ich im Winter, denn im Hinterkopf nisten die Schatten: Oberarmbruch und Operation, schmerzreich und schlafarm in den Krankenzimmernächten; daheim längere Zeit angewiesen auf die Hilfe von Freunden und Fremden. Jene Welle, die da auf uns zurollt, erscheint noch unwirklich. Geschehen solche Dinge nicht gewöhnlich in anderen Ländern? Meine Buchlesung fällt vorerst weg? Ist mir recht, hab ja noch Schwierigkeiten beim Autofahren. Aus der Traumreise wird auch nichts? Na ja, im Grunde wäre das noch problematisch, mit Gepäck zwischen Bus und Hotels. Für mich passt alles ziemlich zusammen. Für dieses Jahr ist auch kein neues Buch geplant, darum darf ich jetzt spielerisch schreiben, ohne den Druck, es müsse „etwas daraus werden“. Und schreiben kann ich ja zumindest, mit der Hand, denn welch ein Glück, der rechte Arm ist nicht betroffen. In anderer Hinsicht muss ich gleichfalls dankbar sein, bin zwar Mitglied der Risikogruppen, doch eben deshalb alt genug für eine Rente, ein Geldflüsschen, das monatlich sickert. Viele meiner Kollegen hingegen … und dazu all die anderen Künstler … Krankenpfleger mit allzu viel Arbeit, Gastronomen mit nahezu keiner … Das nimmt mich mit, doch geht mein Leben seinen Gang.
Dann aber darf ich nicht ins Heim zu meiner Mutter. Achtundneunzig ist sie, und ich darf sie nicht besuchen und nicht herausholen, nicht in den Garten fahren, nichts mit ihr erleben. Und für sie ist das alles noch schwerer. Sie ist tapfer. Auch andere sind es. Der Gefangenenchor weht zu mir. Das Mosaik der Sänger, die flatternde Fahne über kaum noch betretbaren Plätzen … Mein geflickter, verweigernder Arm erlaubt mir Wege bis zur Physiotherapie, in den Straßen, leer wie 12 Uhr mittags.
Bald ist mehr möglich. Aber ich darf auch meine schwesterliche Freundin nicht mehr treffen. Sachsen, zehn Kilometer entfernt, ist zur Tabu-Zone geworden. Hinter Grenzen liegen die Lieblingsorte: Teiche, See und Wald. Näher rückt mir die nächste Umgebung. Es ist alles hier: Wald, See und Teich. An manchen Orten war ich jahrelang nicht mehr, andere waren mir nur Stippvisiten wert. Und nun sitz ich allein auf der Bank und bin nicht wirklich hier, aufgrund all der Gedanken.
Sonne flimmert in frischgrünen Bäumen und auf schneeweißen, goldgelben Flecken unbeirrbar sich breitender Blüten. Lange still sitze ich in der Stille … Rascheln, schräg hinter mir am Hang. In aller Ruhe schiebt sich ein Hase auf den Weg hinaus, verharrt. So was hab ich noch niemals erlebt – er arglos neben mir, ich für ihn Teil des Waldes. Gelassen sichtet er die Chancen dieses Pfads und entschließt sich dann weiterzuziehen.
Niemand wartet auf mich irgendwo. Ganz allein unterwegs sein, das hat etwas Eigenes. Ich breche auf, wann es sich eben so ergibt, fahre entspannter. Dann gehen, stehen, schauen, zuhören – nicht Worten; auch nicht in meinen Worten verfangen, die sich von all dem Leben abwenden, das ringsum atmet, schwingt und singt, nur jetzt so da ist; das uns durchströmt und uns erinnert, wer wir sind.
Aber dann endlich wieder zusammen! Welch ein Geschenk ist dies – das beinah pralle Leben. Die Gärten öffnen sich. Der See lässt uns nun ein, sogar das Meer, für vierzehn Tage im September. Themen tauchen herauf, über die ich in meiner Jugend schrieb. Sie locken mich hinüber zu neuen Storys mit recht alten Wurzeln, und ich fühle mich jünger und reifer. Sie müssen nicht verwertbar sein. Sie zu gestalten ist erfüllend für mich, hält mich oben.
Herbst. Verschobenes kann nachgeholt werden. Wir laden Schüler ein, die schreiben, und wir staunen über manche bewegende Tiefe. Ich weiß auch, die Kollegen tun viel, bauen an Flößen zu den Ufern, suchen neue … Ich selbst bin eher auf „Verinnerung“ gepolt, während wieder die Pforten sich schließen.
Meine Mutter im Zimmer-Asyl. Keine Gesprächsrunden, kein Singen und kein Sport. Und vor allem: nie ich auf der Schwelle. Aber wir können telefonieren, dabei kann ich ihr etwas erzählen, mal etwas vorlesen. Wir bleiben doch verbunden.
Eine Beobachtung der Welt aus jenem Abstand des entschleunigten Daseins heraus schärft den Blick auf den Kessel des Lebens, das als normales Leben angenommen wird. Der großen Gier wurde die Krone aufgesetzt; ein gequälter Baum bringt kranke Früchte. Ich denke an die vielen Menschen, die jetzt leiden. Aber ich denke auch an die Tiere, die wir ums eigene Leben betrügen, denk an Lärm, Sucht und Hast, Spaß-Gedränge … Es ist, als lebten wir auf einem anderen Stern. Wünschen wir nur, der wär bald ganz wie der gewohnte?
Nun ist der Sonnenmonat November. Die Natur widerspricht düsterer Stimmung, die jetzt zu herrschen hätte. Zwar ist mir die Krankheit mittlerweile noch näher gerückt, es sind Freunde, Verwandte betroffen; zwar gibt es auch so einige Dinge, die ich vermisse, aber nicht so sehr vermisse, wie ich mir vorher ausgemalt hatte. Ich lese Bücher, wähle Filme, die mir guttun. In mir arbeitet eine Geschichte, vielleicht ein guter Weizen in der hübschen Spreu, die ich in dieser Zeit fabriziere. Und ich höre Musik, die tief eindringt. Sie löst Schweres in mir, lässt mich lächeln, lässt mich schwingen. Es regt sich in mir dann und wann unerwartete Freude, abgedunkelt von Melancholie, Traurigkeit oder Sehnsucht, ich weiß nicht. Aber stark ist sie doch, diese Freude – bloß weil das Kerzenlicht in blauem Glas sich bricht?
Draußen, am scheinbar reglosen Wasser, spiegeln sich dunkelgelbe und rostrote Bäume. Es ziehen Gänsekeile schreiend hin und her, als könnten sie den größeren Aufbruch kaum erwarten. Wolken werden zu wandernder Glut.
Nein, dies Jahr ist für mich nicht verloren. Und das Wort wurde mir nicht verleidet. Es gibt ja auch noch die Corona Borealis, jenes funkelnde Sternbild im All.

Elisabeth Dommer, 1951 in Altenburg geboren, arbeitete als Grundschullehrerin und studierte am Literaturinstitut Leipzig. Seit 1982 arbeitet sie nebenberuflich, seit 1986 freischaffend als Schriftstellerin. Ihre jüngste Veröffentlichung ist das Buch „Der unheimliche Zauber der Sterne“ (Aachen 2019).
Zum Eintrag in der Autoren-Datenbank hier.